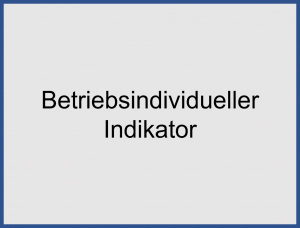Johanna Huber
ZGT34: Brutpaare einer Vogelart ziehen erfolgreich Junge auf
Mindestens $1 Paare $2 sollen erfolgreich Junge aufziehen.
Durch die Beobachtung und die Dokumentation der Vermehrung einer bestimmten Tierart auf deiner Fläche trägst du dazu bei, die Ansprüche dieser Art besser zu verstehen und für ihren Fortbestand Sorge zu tragen.
ZGT33: Tierart zieht erfolgreich Junge auf
$1 soll erfolgreich Junge aufziehen.
Durch die Beobachtung und die Dokumentation der Vermehrung einer bestimmten Tierart auf deiner Fläche trägst du dazu bei, die Ansprüche dieser Art besser zu verstehen und für ihren Fortbestand Sorge zu tragen.
ZGT32: Es gibt ausreichend Nahrungsflächen rund ums Nest (Braunkehlchen)
Es gibt ausreichend Nahrungsflächen in Form von insektenreichen Wiesen rund um den Neststandort.
Besonders artenreiche Lebensräume haben viel Struktur. Struktur entsteht durch unterschiedliche Formen, gestaffelte Entwicklungsräume (z.B.: durch Bewirtschaftung), abwechslungsreiche Angebote an Lebensraum und Nahrung. Braunkehlchen bevorzugen flache, hochwüchsige Wiesen mit Strukturelementen als Sitz- und Singwarten und als Lebens- und Brutraum. Können bestandbildende Gräser und Kräuter aussamen, ist die Qualität der charakteristischen Arten gegeben. Auf den ausblühenden Pflanzen können sich Insekten entwickeln und vermehren, diese wiederum bieten eine Nahrungsquelle für die Jungenaufzucht.
ZGT31: Braunkehlchenpaare ziehen erfolgreich Junge auf
$1 Braunkehlchenpaare sollen erfolgreich Junge aufziehen. Dass sich Braunkehlchennester in der Wiese befinden, erkennt man daran, dass die Altvögel Sitzwarten im unmittelbaren Nahebereich benutzen und immer wieder mit Insekten im Schnabel im Gras verschwinden.
Das Braunkehlchen ist ein Wiesenbrüter der vorzugsweise in flachen, zweischnittigen Fettwiesen brütet. Da viele dieser Wiesen früher und häufiger gemäht werden, weicht das Braunkehlchen auf nasse Fettwiesen oder sogar Hanglagen und teilweise Magerwiesen aus. Um erfolgreich Junge aufzuziehen, brauchen sie Ruhe, Sichtschutz und Strukturelemente, wie großblütige Stauden (Kohl- und Sumpfdisteln, Engelwurz, …), die als natürliche Sitz- und Singwarten genutzt werden. Das Nest wird am Wiesenboden angelegt. Bei hohem Gras ist das Nest nicht zu finden, außer du kannst Eltern beim Füttern der Jungvögel beobachten.
ZGT30: Mindesthöhe der Vegetation im Zeitraum
Die durchschnittliche Vegetationshöhe ist im Zeitraum $1 mindestens $2 cm hoch.
Eine Mindest-Höhe der Vegetation kann verschiedene Zwecke erfüllen. Zum Beispiel brauchen einige Tiere einen Sichtschutz: So benötigt der Wachtelkönig zum Brüten mindestens 20 cm Vegetationshöhe zwischen Mitte Juni bis Mitte August. In trockenen Gebieten mit wenig Jahresniederschlag schützt eine gewisse Bestandes-Höhe, den Boden und den Wurzelraum vor Austrocknung und Überhitzung. Die durchschnittliche Bestandes-Höhe ist jener Bereich, den die meisten Pflanzen erreichen.
ZGT29: Förderung von Pflanzenarten für Wildbienen
Förderung von für die Wildbienenfauna herausragenden Pflanzen auf artenreichen Fettwiesen wie zum Beispiel: Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), Margerite (Leucanthemum vulgare), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Wiesen-Schaumkraut (Cardamina pratensis), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea) und Rot-Klee (Trifolium pratense) und/oder Wiesen-Salbei (Salvia pratensis).
Wildbienen sind eine riesige Artengruppe, zu der auch Hummeln und Wespen gehören. Sie sind neben den Fliegen unsere wichtigsten Bestäuber, auch im Kulturland. Wenn die Honigbiene das Rind (Nutztier) auf der Wiese ist, ist die Wildbiene der Auerochse (Wildform). Um genug Nahrungsangebot an Pollen und Nektar für Kultur- und Wildart zu schaffen, sind blütenreiche Wiesen mit standorttypischen Pflanzenarten wichtig.
ZGT28: Förderung von Pflanzenarten als Nahrungsquelle für Insekten
Förderung von Silberdistel (Carlina acaulis), Kümmel (Carum carvi) und Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) als Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten wie zum Beispiel die Streifenwanze.
Sind Kulturbestände artenreich, ist auch das Insektenspektrum breit gefächert. Einige Insekten wie Wespen, Heuschrecken und räuberische Fliegen sind Fleischfresser und halten sich stark ausbreitende Insektenarten wie Läuse oder Raupen, etc. in Schach. Manche Pflanzenarten, wie z.B. Veilchen, Leberblümchen und Flockenblumen, haben ihren Samen ein bekömmliches Fettanhängsel mit Zucker, Vitaminen und Eiweiß mit eingepackt, damit z.B. Ameisen sie mit unter die Erde in ihre Vorratskammern eintragen. Wanzen saugen an Pflanzenhalmen und Samen, zum Beispiel die Streifenwanze, die gerne an Doldenblütler, wie Möhre, Fenchel oder Mannstreu saugt.
ZGT27: Es gibt vertikale Strukturen u. niederwüchsige Bereiche
Es gibt sowohl vertikale Strukturen (Gebüsche, Gebüschgruppen in den Randzonen oder/und höhergrasige Bereiche) als auch niedrigwüchsige Bereiche.
Besonders artenreiche Lebensräume haben viel Struktur, in der es Platz für Nischen gibt. Jede Nische hat ihre Spezialisten. Beispielweise gibt es Heuschreckenarten, wie die Lauchschrecke oder den Warzenbeißer, die bevorzugt in der Wiese zu finden sind, während andere, wie das Große Heupferd oder auch die Zwitscherschrecke in hochwüchsigen Strukturen oder in Hecken und Gebüschen zirpen. Vögel in Kulturlandschaften brauchen Sitzwarten, wie großblütige Dolden oder Disteln und Gehölze, um Nahrung zu suchen, zu sammeln oder um zu singen. In niederrasigen Bereichen sind Ameisen für den Grünspecht leichter aufzufinden.
ZGT26: Frei formulierter Indikator zu Tieren
$1
Diesen Indikator hat der/die BeraterIn speziell für die Gegebenheiten dieser Fläche und gemeinsam mit dir formuliert.
ZGT25: Es gibt künstliche Bruthöhlen
Es gibt mindestens $1 künstliche Bruthöhlen für $2.
Das Vogelhaus muss an die dort brütende Art angepasst sein. Ein wichtiger Faktor ist z. B. die Größe des Einflugloches.

Diese Website verwendet keine externen Trackers, keine Analytics, nur Session-Cookies und sie respektiert deine Privatsphäre.